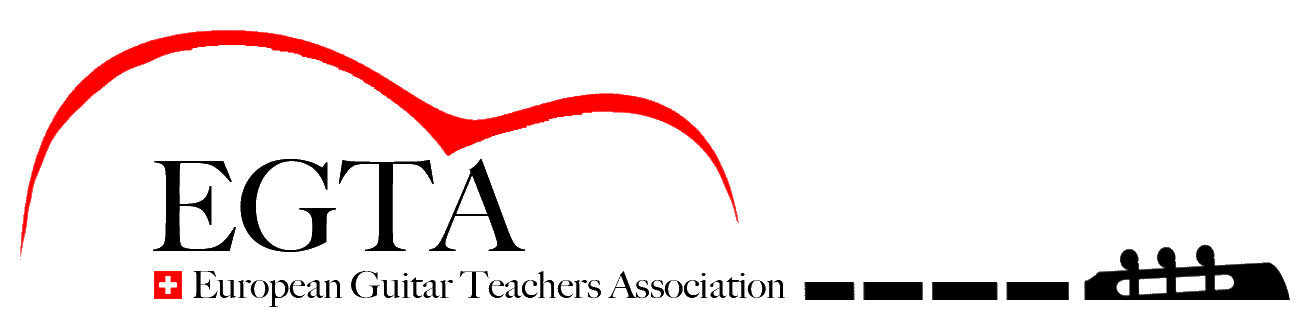Über die Schwierigkeit von der (pädagogischen) Theorie in die Praxis zu kommen
von Michael Boner
Für mich persönlich war es seit jeher so, dass ich pädagogische Literatur immer sehr spannend fand. Pädagogische Thesen und Theorien können einem einen ganz neuen Blick auf das eigene Tun als Gitarrenlehrer*in geben, den Blick für einzelne Elemente unserer Arbeit schärfen und auch auf neue Ideen und neues methodisches Vorgehen bringen. Gleichzeitig spüre ich von Zeit zu Zeit in Gesprächen aber auch eine gewisse Zurückhaltung und Skepsis aus dem Lehrerkollegium gegenüber solchen Theorien. Vor kurzem meinte ein Kollege „ich bin halt mehr der Praktiker…“. Für solche Aussagen habe ich durchaus Verständnis. Ich merkte auch bei mir selber, dass der Schritt von der Auseinandersetzung mit der Theorie zum Nutzen in der Praxis je nach dem recht gross sein kann.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich auch an ein Input-Referat, an dem ich vor etwa sechs Jahren an der Zürcher Hochschule der Künste teilnahm. Der Referent, Andy Brugger, begründete seine Thesen auf folgender Beobachtung: wenn man Studierenden pädagogische Theorien an die Hand gibt und sie diese in realen Unterrichtssituation umsetzen versuchen lässt, kann man sehr oft bis zu einem gewissen Grad ein Scheitern beobachten, da Theorien eben immer nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit abbilden, und eine dogmatische Umsetzung einer Theorie also auch meist an der Realität vorbei geht. Zudem stellt er die Wichtigkeit von deklarativem Wissen (knowing that, Wissen über Theorien) gegenüber dem prozeduralen Wissen (knowing how, das Wissen auf das man intuitiv ohne zu überlegen beim Handeln zugreifft) für eine gelingende Unterrichtssequenz quasi komplett in Frage:
"[…] Gute Theorie muss, gute Praxis aber kann nicht wissenschaftlich sein. Kurz warum: weil sie nicht reduzibel ist, sondern immer mehr als eine Summe von Einzelaspekten (Stichwort: Emergenz).Mehr als Einzelaspekte aber bietet Theorie nicht. […]"
"[...] Meine These: wir brauchen all das nicht. Was wir damit verlieren ist viel wichtiger, als was wir damit gewinnen.“
Diese Sichtweise war gerade für einen Hochschulkontext natürlich provokativ gesetzt, und rief auch bei mir (und vielen Anwesenden) einen gewissen Widerstand hervor, da ich zwar die kritische Haltung sehr wohl verstehen kann und man die Schwierigkeit deklaratives und prozedurales Wissen zu verbinden auch in der Praxis beobachten kann, jedoch stehen diese Aussage meinem Empfinden von einer Bereicherung durch pädagogische Theorien entgegen. Ein pädagogisches Handeln, das sich nicht in gewisser Form auch theoretisch reflektieren lässt, widerstrebt mir zudem grundsätzlich. Nur lässt sich aber wie gesagt die Schwierigkeit der Verbindung von deklarativem und prozeduralen Wissen nicht wegdiskutieren.
Vor etwa einem Jahr wurde ich auf einen Artikel im Magazin üben & musizieren aufmerksam, in dem es um genau die genannte Schwierigkeit geht. Der Artikel bespricht zwar die Herausforderung primär im Kontext einer pädagogischen Hochschulausbildung, jedoch, denke ich, ist er genauso für alle Lehrpersonen ausserhalb der Hochschule spannend. Die Autoren Andreas Doerne und Wolfgang Lessing beschreiben, dass der Antagonismus zwischen dem deklarativen und prozeduralen Wissen eigentlich dadurch entsteht, dass man unmöglich in einer Unterrichtssituation an die Bewältigung einer Situation und gleichzeitig an den Grund für diese Bewältigung denken kann. Um auf das deklarative Wissen zugreiffen zu können, müsste man sich in der spontanen Situation quasi Zeit nehmen die Situation zu analysieren und wäre folglich in diesem Moment im Handeln blockiert. Das spannende am Artikel finde ich dann vor allem den Lösungsansatz der Autoren: um aus diesem Dilemma zu entkommen braucht es laut ihnen neben dem „knowing how“ und dem „knowing that“ auch noch ein „knowing with“.
"[...] Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit: die des „knowing with“. Hiermit ist eine Haltung gemeint, bei der es weder um den fragwürdigen Versuch geht, durch Theorie die Praxis erklären zu wollen, noch um eine theoriefreie Zone des praktisch-prozeduralen Tuns. Im Zustand des „knowing with“ versuche ich, die Welt quasi spielerisch durch die Brille eines theoretischen Entwurfs zu betrachten und damit zur Grundlage meines Handelns zu machen. Das geschieht etwa, wenn eine Studentin es sich zum Ziel setzt, in einem Unterrichtsversuch probeweise einmal ganz auf spieltechnische Anweisungen zu verzichten, um alle instrumentalen Handlungen, die sie und ihre Schülerin ausführen, im Modus des Musizierens zu realisieren. Die „Brille“, mit der sie an diese Stunde herangeht, kann zwar auf durchaus komplexen theoretischen Erwägungen beruhen, d och [sic] in dem Moment, in dem sie sich der Stunde aus dieser Perspektive nähert, sieht sie nicht die Begründungen, sondern allein die Situation, die daraus entsteht. Wer durch eine Brille schaut, sieht mit ihrer Hilfe („knowing with“) die Welt – und gerade nicht die Brille."
(Quelle: “Durch die Brille des “knowing with”, von Andreas Doerne und Wolfgang Lessing, erschienen in: üben & musizieren 5/2020 , Herausgegeben von Schott Music, Mainz)
Sie schlagen also vor, Situationen zu kreieren, in denen man anhand von theoretischen Überlegungen praktische Unterrichtssequenzen generiert, und dabei mit einem spielerischen Ansatz mit diesen Konzepten experimentiert. Man kann quasi in der Praxis erproben wie sich ein gewisses anhand der Theorie generiertes methodisches Vorgehen anfühlt. Der Begriff "knowing with" kommt davon, dass man in diesem Moment MIT der Theorie arbeitet, aber nicht mehr darüber nachdenkt. Hier ist genau der Punkt: man kommt vom Denken ins Gefühl, vom Deklarativen ins Prozedurale. Wenn ich in der „knowing with“-Situation Erfahrungen sammle, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich in einer spontanen Situation darauf zurückgreifen kann als wenn ich nur darüber nachgedacht habe. Dass man sich in eine spielerisch-experimentierende Haltung begibt, ist wichtig um flexibel und spontan zu bleiben und nicht dogmatisch eine Theorie durchführt. An der Musikhochschule Freiburg wurde deshalb das Fach Unterrichtslabor ins Leben gerufen, bei dem genau solche Erfahrungen aufgebaut werden sollen.
Natürlich ist eine Hochschule wohl der beste Ort um solche Experimente zu machen. Im geschützten Hochschulrahmen dürfen und sollen Sachen auch misslingen. Beim Lesen des Artikels machte ich mir aber auch einige Gedanken, wo im Musikschulalltag denn noch solche Freiräume zu finden sind, wo man ins "knowing with" kommen kann. Im "Ernstfall" einer Unterrichtslektion greifft man ja dann doch meist lieber zu Bewährtem (wodurch sich das prozedurale Wissen eben nicht erweitert).
Ob man "knowing with" nun als dritte Form des Wissens neben das Prozedurale und das Deklarative stellen kann sei dahingestellt. Ich denke eher, dass es einfach ein Übungssetting ist, welches hilft die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überwinden. So unspektakulär dieses Setting auch sein mag, habe ich aktuell das Gefühl, dass dieser Zwischenschritt oft nicht in betracht gezogen wird, man versucht von der Theorie direkt in die Praxis zu gehen, und vielleicht ist ja das genau der Grund weshalb viele pädagogische Theorien als praxisfern ("ich bin halt mehr der Praktiker...") wahrgenommen werden.